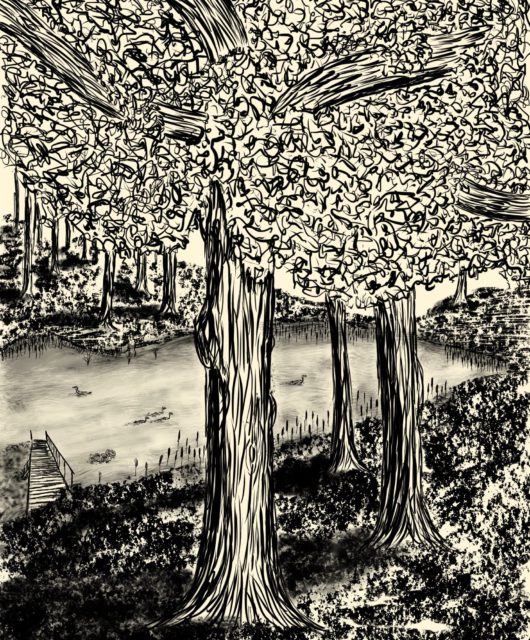Knapp drei Jahre ist es her, seit die Studierenden mit ihrer Forderung nach einem vereinheitlichten und existenzsichernden Stipendienwesen an der Urne Schiffbruch erlitten. Die Kontroverse um die Unterstützungsgelder dauert jedoch an.
Studiengebühren, Lehrbücher, Unterkunft, Verpflegung, Erwerbsausfall – wer studiert, hat einen grossen finanziellen Aufwand. Wer in der Schweiz für all diese Aufwendungen nicht aus eigener Kraft aufkommen kann, hat die Möglichkeit, staatliche Ausbildungsbeiträge zu beantragen. Ob man schlussendlich jedoch ein Stipendium oder ein Ausbildungsdarlehen erhält, hängt in der Schweiz stark vom Wohnort ab: Jeder der 26 Kantone hat ein eigenes Stipendienwesen. Gegen diese Ungleichheit lancierte der Verband der Schweizer Studierendenschaften (VSS) eine eidgenössische Volksinitiative, die die Vereinheitlichung des Stipendienwesens und die Erhöhung der Beiträge für die Studierenden vorsah.
Kantonale Mindeststandards
Die nationale Mobilisation der Studierendenverbände führte schliesslich dazu, dass immer mehr Kantone einem Konkordat beitraten, welches Mindeststandards für die Vergabe von Ausbildungsbeiträgen vorsieht. Der Bund unterstützte diese Entwicklung mit Zuschüssen an die Kantone. Die Volksinitiative selber wurde jedoch im Sommer 2015 klar abgelehnt. Auf dem Konkordatsweg indes schritt die Vereinheitlichung weiter voran: Zu Beginn dieses Jahres beschloss mit Schaffhausen der letzte Kanton, ebenfalls beizutreten. Ist in absehbarerer Zeit also die Forderung der Stipendieninitiative nach gleichem Bildungszugang für alle erfüllt? Die Antwort lautet: Jein. Denn während die Vereinheitlichung des Stipendienwesens tatsächlich vorangetrieben wurde, blieb der Anspruch, durch die Beiträge einen minimalen Lebensstandard gewährleisten zu können, zurück.
Kein gesichertes Existenzminimum
Die Volksinitiative verlangte eine Orientierung der gewährten Ausbildungsbeiträge am sozialen Existenzminimum der Sozialhilfe, welches neben Wohnkosten und medizinischem Grundbedarf auch einen Grundbedarf für den Lebensunterhalt von jährlich 11’832 Franken vorsieht. Das Stipendienkonkordat regelt die Höhe der Beiträge nur insofern, als es einen gemeinsamen jährlichen Höchstbetrag von mindestens 16’000 Franken fordert. Den Kantonen ist es also weiterhin möglich, erheblich weniger als das soziale Existenzminimum zu finanzieren, was in unterschiedlichem Masse auch gemacht wird – 2016 betrug die durchschnittliche Stipendienleistung pro Jahr 8’600 Franken. Ausbildungsbeiträge haben damit weiterhin eher die Funktion, die nötigsten Löcher bei Armutsbetroffenen zu stopfen und nicht, wie vom VSS gefordert, in die Bildungsgerechtigkeit aller zu investieren. Ein weiterer heikler Aspekt bezüglich des Umfangs der Leistungen ist, dass zumindest ein Teil der Stipendien durch einmalige Studiendarlehen ersetzt werden kann, welche nach Abschluss der Ausbildung zurückgezahlt werden müssen. Trotz der Kritik von Studierendenorganisationen, dass diese Verschuldung von finanziell schlecht gestellten Studierenden der Allgemeinzugänglichkeit von Bildung zuwiderläuft, hat die Bevölkerung des Kantons Aargau am vergangenen 4. März eine Volksinitiative, die genau dieses Modell umsetzen will, deutlich angenommen.
Andauernde Unterschiede
Auch beinahe drei Jahre nach dem Abstimmungskampf um die Stipendieninitiative bleibt das Thema Ausbildungsbeiträge auf der unipolitischen Agenda. Der VSS fordert nach wie vor, dass die Studierenden grössere finanzielle Unterstützung erhalten und die Vereinheitlichung ist durch das Stipendienkonkordat nur in Bezug auf einige Rahmenbedingungen erreicht worden. Die Beiträge pro Einwohner oder Einwohnerin des Kantons reichen weiterhin von 16 (Zug) bis zu 73 Franken (Genf), die Bezugsquote variiert zwischen drei Prozent (Zürich) und 21 Prozent (Graubünden) und auch der durchschnittliche Betrag, den die Bezügerinnen und Bezüger erhalten, unterscheidet sich stark; Wallis entrichtet unter 6’000, die Waadt über 12’000 Franken. Ob die andauernden Ungleichheiten durch den kantonalen Bildungsföderalismus zu rechtfertigen sind oder ob es schlussendlich nicht doch eines Eingriffs des Bundes bedarf, ist folglich eine Frage, die wohl bald wieder auf der politischen Agenda stehen wird.