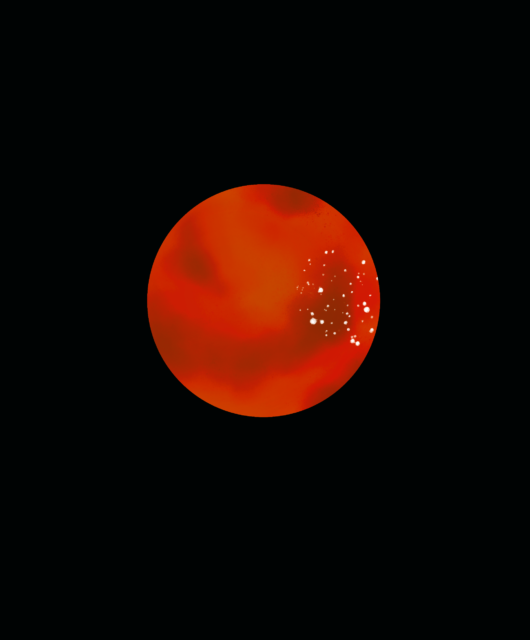Ich sehe dir dabei zu, wie du dein Leben in die Pappkartons packst, die wir bei IKEA gekauft haben. Deine Klamotten. Deine Bücher. Die CDs.
«Willst du mir nicht helfen?», fragst du.
«Nein», antworte ich und meine es so, denn ich will dir nicht dabei helfen, mich zu verlassen.
Du zuckst bloss mit den Schultern, kein bisschen verärgert. Statt zu schweigen, malst du dir aufgeregt das Leben aus, das dich bald erwartet. So weit weg. Auf einem anderen Kontinent. In einem Land, in dem ich noch nie war. Irgendwann höre ich auf, dir zuzuhören. Ich starre aus dem Fenster. Die Sonne scheint und tunkt die Plattenbauten in helles Licht. Über den flachen Dächern kreisen drei Milane. Im Innenhof kreischen Kinder und ich höre unseren Nachbarn von nebenan auf dem Balkon telefonieren. In deinem Zimmer ist es drückend heiss. Die Zimmerpflanze, die im Makrameenetz hängt, ist schon ganz vertrocknet. Doch das spielt eh keine Rolle mehr. Die nimmst du ja nicht mit. Die bleibt hier und ich habe sowieso keinen grünen Daumen.
«Hey! Bist du da?» Du schnippst mit den Fingern vor meinem Gesicht. Ich zucke zusammen. «Hast du Hunger?»
Noch bevor ich den Mund öffnen kann, verlässt du das Zimmer und holst die Pizza von letztem Abend aus dem Kühlschrank. Wir essen sie kalt, auf dem Boden deines beinahe ausgeräumten Zimmers hockend und krümeln auf die Schachteln, die mit Fettflecken übersehen sind. Danach schälst du eine Orange, weil du noch nicht satt bist. Sogar das weisse Geflecht pulst du vom Fruchtfleisch. Du reichst mir eine der Hälften. Orangen erinnern mich an dich. Du riechst immer ein klein bisschen nach den Zitrusfrüchten. Vielleicht ist das auch bloss Einbildung. Du liebst Orangen, genauso wie du Emma von Jane Austen und deine Jeansjacke mit den bunten Flicken liebst. Ich kenne dich besser als meine Eltern oder meine Brüder. Du bist meine Familie. Ich vertraue dir alles an. Du bist immer für mich dagewesen, hast mich getröstet und mich in deinen Armen gehalten. Niemand kann mich so zum Lachen bringen wie du. Zusammen sind wir durch dick und dünn gegangen. Und bald schon trennen sich unsere Wege.
«Wie kannst du nur?», will ich dich fragen, aber ich tue es nicht.
Du hast mich gleich um Rat gefragt, als du das Jobangebot erhalten hast. Zwar hast du an deinem Daumennagel geknabbert, doch das aufgeregte Funkeln in deinen Augen hat dich verraten. «Was meinst du?»
Am liebsten hätte ich nein gesagt. Allerdings hätte ich mir dann wohl nie verzeihen können, denn ich habe ja sehen können, wie sehr du es willst. Schon seit Jahren hast du davon geträumt, dieser Stadt zu entkommen, in der wir gemeinsam aufgewachsen sind. Dass du tatsächlich mal gehen würdest, damit habe ich jedoch nicht wirklich gerechnet und nun fühle ich mich verraten. Ausserdem macht es mir Angst – von dir zurückgelassen zu werden. Der Saft der Orangenschnitze rinnt uns über die Finger und tropft auf die Pizzakartons.
Wir schweigen.
Die nächsten Tage ignorieren wir den bevorstehenden Abschied. Wir spazieren durch den Park. Im Freibad schwimmen wir eine Bahn nach der anderen. Mit der Strassenbahn fahren wir kreuz und quer durch die Stadt, verhalten uns wie Touristen und knipsen dutzende Fotos. Wir gehen in dem Restaurant essen, das von den Kritiken in den Himmel gelobt wurde. Die irrsinnig kleinen Portionen bringen uns zum Lachen. In einem Klub tanzen wir, bis uns die Haare verschwitzt im Nacken kleben. Wir kicken mit den Nachbarskindern im Innenhof und jubeln, reissen die Arme hoch, wenn es uns gelingt, den Ball in die Tore zu befördern, an denen die Netze fehlen. Abends liegen wir auf der Couch, ziehen uns Filme rein und löffeln Ben & Jerrys. Ich will die Zeit anhalten. Oder noch besser: sie zurückdrehen. Keiner von uns kann sich daran erinnern, wie wir uns kennengelernt haben. Du warst einfach schon immer in meinem Leben. Mit den krausen Locken, dem zahnlückigen Grinsen und der Latzhose.
Dann ist der Tag da. Mit den ersten Sonnenstrahlen bist du aufgestanden und zum Bäcker um die Ecke gegangen. Die Papiertüte in deinen Händen knistert. Die Brötchen sind noch warm und lassen die Butterflocken schmelzen. Das Ticken der Küchenuhr erscheint mir lauter als sonst. Sie erinnert mich an die wenigen Stunden, die uns gemeinsam bleiben. Ich hänge sie ab und bringe sie ins Bad, ziehe danach die Tür hinter mir kräftig ins Schloss. Stille.
Wir stehen in deinem Zimmer. Der Raum, der voll von dir gewesen ist, ist jetzt leer. Die Poster und die Fotos hast du von den Wänden genommen. Nur ihre rechteckigen Schatten sind an der Tapete zurückgeblieben. Du schliesst deine Augen und atmest tief ein und aus. Ich schaue dich an, habe Angst. Nicht nur vor dem Alleinsein. Sondern auch deswegen, weil ich weiss, dass du nicht mehr dieselbe Person sein wirst, wenn wir uns wiedersehen.
«Komm, lass uns gehen», meinst du schliesslich und berührst mich sachte am Ellenbogen.
Ich nehme dir den Koffer ab und ziehe ihn hinter mir her. Er klackert über die Pflastersteine. Du hast bequeme Kleidung an: eine Leggings, ein T-Shirt, das dir zu gross ist, um die Hüfte hast du dir einen Kapuzenpulli geknotet. Als wir die Siedlung verlassen, drehst du dich um und bleibst für einen kurzen Moment stehen. Du hebst die Hand und winkst den Plattenbauten zu. Im Zug frage ich mich, ob ich nicht lieber hätte zu Hause bleiben sollen, denn ich bin mir nicht sicher, ob ich genug Kraft für den Abschied habe. Gleichzeitig ist mir natürlich klar, dass es feige gewesen wäre, nicht mitzukommen.
Der Flughafen ist Endstation. Ich bin erst zum zweiten Mal hier. Um dich nicht aus den Augen zu verlieren, greife ich nach deiner Hand. So viele Menschen, so viele Sprachen. Alle paar Minuten erklingt eine Durchsage. Das unruhige Treiben macht mich nervös. Du ziehst mich zu den riesigen Fenstern. Wir beobachten die Flugzeuge beim Abheben und beim Landen. Ein kleines Mädchen drückt ihr Gesicht gegen die Scheibe. Sie kichert. Ihre Finger hinterlassen schmierige Abdrücke auf dem Glas. Ich habe dutzende Fragen an dich und tausend Dinge, die ich dir noch erzählen möchte. Jetzt gleich. Hier. Doch da ist ein dicker Kloss in meinem Hals und ich bringe kein einziges Wort raus. Du spürst meinen Blick auf dir ruhen und lächelst mich an – zittrig, wie mir scheint. Dein Flug wird aufgerufen. Du hebst die Schultern, greifst nach deinem Koffer. Ich fange an zu weinen und kann nicht mehr aufhören. Vom Schluchzen kriege ich Schluckauf, habe das Gefühl, zu ersticken. Du streichst mir über den Rücken.
«Ich komme ja wieder», versuchst du mich zu trösten.
Die Frage ist nur wann. Wann du wiederkommst. Wann wir uns wiedersehen.
Ich mache mir Sorgen darüber, dass wir uns aus den Augen verlieren. Dass die Anrufe immer seltener werden. Dass du schliesslich zu einer Erinnerung wirst.
«Ach, Mist.» Jetzt weinst du auch, wischst dir mit dem Handrücken über die Wangen.
Wir umarmen uns und du versicherst mir: «Das ist ein Aufwiedersehen.»
Ich drücke dich an mich, klammere mich an dir fest. Minuten? Stunden? Eine gefühlte Ewigkeit. Trotzdem immer noch viel zu kurz. Dann lasse ich dich los, lasse dich gehen. Nehme Abschied.