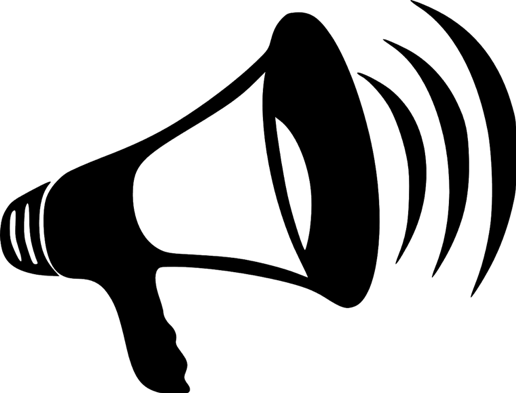Kann Innovation in der Wissenschaft (noch) gewährleistet werden oder braucht es einen Systemwandel?
Als Robert Malone die Zellen betrachtet, leuchten sie. Acht Stunden vorher hatte er eine winzige Menge mRNA mit einer fetthaltigen Lösung vermischt und menschliche Zellen darin gebadet. Dabei wurde der Botenstoff, der den Bauplan für ein fluoreszierendes Protein enthielt, in Fett eingehüllt und so in die Zellen geschleust. In sein Notizbuch schreibt er: «treat RNA as a drug». Was nach der Beschreibung der neuen Covid-Impfung klingt, fand bereits im Jahr 1987 statt. Erstaunlicherweise entscheidet sich Malones Institut dagegen, die neue Entdeckung patentieren zu lassen. Als er daraufhin auf eigene Faust an einer auf mRNA basierenden Impfung forschen will, kann er keine Forschungsgelder auftreiben. Ähnliches erlebten viele andere Wissenschaftler:innen. Die Biochemikerin Katalin Karikó etwa arbeitete ab den späten 1980ern an mRNA-Applikationen. Sie erhielt so wenig Interesse von Förderungsinstitutionen, dass sie 1995 von ihrer Universität degradiert wurde. Nur ihr unerschütterlicher Glaube an das Potential ihrer Arbeit liess sie weiter machen. Heute wird Katalin Karikó oft als «Mutter der Impfung» bezeichnet.
Sind alle einfach zu findenden Ideen schon gefunden worden?
Mit solchen Fallbeispielen illustriert eine stetig wachsende Anzahl an Wissenschaftler:innen ihre These: Die Art und Weise, wie Wissenschaft betrieben wird, unterdrückt Innovation. Eine Publikation von 2020 möchte zeigen, dass das Finden neuer Ideen in allen Fachgebieten schwieriger wird. Heute brauche es beispielsweise 18mal so viele Forschende wie noch in den 1970er Jahren, um alle zwei Jahre die Verdopplung von Transistoren auf einem Computerchip zu gewährleisten. Andere Resultate weisen darauf hin, dass die durchschnittliche Innovationskraft einer Publikation seit Jahrzehnten sinkt. Sind alle einfach zu findenden Ideen wirklich schon gefunden worden? Oder fehlt es dem Wissenschaftssystem an Innovation um neue, ergiebige Forschungsfelder zu eröffnen?
Noch mehr Druck im hyperkompetitiven Umfeld
Auf den ersten Blick stellt diese verringerte Produktivität kein Problem dar. Schliesslich erhöht sich die Anzahl an Wissenschaftler:innen seit Jahrzehnten beständig. Auch der wissenschaftliche Output, gemessen in publizierten Artikeln und Patenten, steigt unaufhaltsam. Die absolute Anzahl an Innovationen bleibt daher konstant. Was allerdings nicht mit diesem Wachstum Schritt hält, sind die bereitgestellten Fördergelder. Die Gelder des amerikanischen National Institutes of Health (NIH), das einen Grossteil der Förderung der Lebenswissenschaften übernimmt, wurden von 2003 bis 2014 um 25% reduziert. Auch beim Schweizerischem Nationalfond (SNF) befürchtet man Budgetkürzungen in den kommenden Jahren. Das generiert Druck in einem ohnehin schon hyperkompetitiven Umfeld, das Erfolg meist mit Quantität gleichsetzt. Möglichst viele Publikationen, in möglichst prestigeträchtigen Zeitschriften, sind der sicherste Weg zu einer unbefristeten Stelle an Universitäten. Forscher:innen sind daher angehalten, ihren Fokus auf möglichst sichere und kurze Projekte zu legen, bei denen ein Erfolg garantiert ist. Noch grössere Chancen habe jene, die sich schon früh auf ein kleines Fachgebiet spezialisieren und damit einer bestimmten Methodik im Laufe ihrer akademischen Karriere treu bleiben. So fehlt am Ende die Zeit und der Mut innovativere Forschung zu betreiben.

Kann gute Forschung in einer Zahl zusammengefasst werden?
Die Idee, dass die Qualität von Forscher:innen vor allem an quantitativen Aspekten festzumachen ist, durchdringt auch die Vergabe von Fördergeldern. Mit sogenannten bibliometrischen Indikatoren werden Anzahl an Publikationen und Zitierungen, eine Wertung der Zeitschriften, aber auch die Resonanz in Sozialen Medien quantifiziert. Die daraus resultierende, nackte Zahl verleiht einen Schein an Objektivität und wurde deswegen als Basis für Geldmittelvergabe verwendet. Schon länger ist jedoch auch klar, dass sie ein verzerrtes Bild wiedergibt. Bei personenbezogenen Indikatoren spielt das wissenschaftliche Alter eine entscheidende Rolle. Forscher:innen am Anfang ihrer Karriere und Frauen, die häufig einer familiären Doppelbelastung ausgesetzt sind, werden klar benachteiligt. Andere Studien zeigen, dass sehr innovative Ideen öfters in weniger renommierten Zeitschriften erscheinen und ihre Zitationen langsamer eintrudeln als vergleichbare herkömmliche Publikationen. Zwischen 2008 und 2012 unterstützte das Schweizer Sinergia-Programm Wissenschaftler:innen, die davor sehr innovative Arbeiten publiziert hatten, um 31% weniger als ihre traditionelleren Kolleg:innen. Um dem entgegenzuwirken, hat der SNF 2014 die DORA-Deklaration unterschrieben. Laut diesen Empfehlungen soll der Gebrauch von bibliometrischen Indikatoren eingeschränkt werden und Projekte stärker nach ihrer Qualität beurteilt werden. Auch wenn hier vielleicht ein Umdenken stattgefunden hat, sind quantitative Indikatoren immer noch Teil des Bewerbungsverfahrens. So werden Bewerber:innen für einen SNF Advanced Grant in der offiziellen Ausschreibung ermutigt «relevant bibliometric indicators» miteinzureichen.
Vom Paradigma in die Krise
Das derzeitige Wissenschaftssystem hat also zur Folge, dass Forscher:innen vermehrt weniger innovative Förderungsgesuche verfassen. Weshalb jedoch werden neuartige Projekte, wenn sie einmal eingereicht werden, auch häufiger abgelehnt? Sollte die Wissenschaft nicht ein intrinsisches Interesse am Neuen haben? Eine mögliche Antwort lieferte uns Wissenschaftsphilosoph Thomas Kuhn schon in den 1960ern. Laut Kuhn arbeiten und denken Wissenschaftler:innen normalerweise innerhalb eines Paradigmas, das festlegt, welche Theorien und Methoden benutzt werden, um die Welt zu verstehen. Mehr noch, das Paradigma gibt vor, was überhaupt als eine valide wissenschaftliche Frage wahrgenommen wird. Wissenschaftler:innen haben in der Regel kein Interesse, am bestehenden Paradigma zu rütteln. Nur wenn man sich gemeinsam auf eine bestimmte Ansicht der Realität geeinigt hat, kann man auch sukzessive Probleme von wachsender Komplexität lösen. Die reine technische Errungenschaft, mRNA in Zellen zu schleusen, ist das Resultat einer solchen «normalen Wissenschaft» und das Produkt von 20 Jahren schrittweiser Verbesserung. Erst die Idee, diese Technik als Therapie einzusetzen, bricht mit dem herrschenden Paradigma, laut dem mRNA im Vergleich zu DNA schlicht zu instabil für den Einsatz in der Klinik ist. So betrachtet, wäre eine Förderung solcher unrealistischen Forschung reine Geldverschwendung. Dass Malone und andere Forscher:innen kurz nach ihm überhaupt auf diese Idee kamen liegt vielleicht daran, dass die Medizin Ende der 1980er Jahre vor einem akuten Problem stand, das mit herkömmlichen Methoden nicht zu lösen war: der AIDS-Pandemie. In dieser Krise, wie Kuhn das Zeitfenster nennen würde, wird das herrschende Paradigma nun doch zunehmend hinterfragt.
Nach der Revolution war sie unausweichlich
Wenn nach der Krise ein neues Paradigma etabliert wird, spricht Kuhn von Revolution. Das Beispiel mRNA zeigt uns, dass diese Wahl oft nicht nur auf wissenschaftliche Ergebnisse zurückzuführen ist. Obwohl von der Mehrheit der wissenschaftlichen Gemeinschaft abgelehnt, forschten einige Wissenschaftler:innen kontinuierlich seit ihrer Entdeckung an der mRNA Technologie. Seit den frühen 2000ern beschäftigt sich auch die Pharmaindustrie damit. Erst die Corona-Pandemie und der Erfolg der mRNA Covid-Impfstoffe brachte über Nacht die Revolution. In diesem neuen Paradigma scheint der mRNA-Ansatz nun mögliches Heilmittel für Infektionskrankheiten, genauso wie für Erbkrankheiten und Krebs. Dabei ist der Erfolg keineswegs garantiert. Bis 2020, noch vor der Pandemie, hatte Moderna bereits neun mRNA-Impfungskandidaten für verschiedenste Krankheiten in klinischen Studien geprüft. Keiner war erfolgreich. War der Corona-Virus ein besonders leichtes Ziel und damit eine Ausnahme? Erst aufbauende und weniger innovative Forschung wird uns hier die Antwort liefern können. Wenn der Immunologe Steve Pascolo in der Tagesschau im Jahre 2021 sagt: «Die Schweiz hat bei der mRNA-Technologie 14 Jahre verloren», weil seine Pläne für eine mRNA-Plattform in Zürich nicht angenommen wurden, dann redet er von einem Standpunkt nach der Revolution aus. Aus einem Paradigma, in dem die mRNA-Technologie als der natürliche Endpunkt der Innovation angesehen wird. Angenommen, die Covid-19 Pandemie wäre einige Jahre früher ausgebrochen, zu einem Zeitpunkt da die mRNA-Technologie noch nicht ausgereift genug war, um schnell ein gutes Resultat zu liefern – hätte sie sich je zu ihrem paradigmatischen Zustand emporgeschwungen?
Die Wissenschaftsförderung ist ein Glückspiel
Das Beispiel der mRNA-Revolution zeigt, wie schwierig es ist, Innovation ausserhalb des eigenen Paradigmas zu bewerten. Oft braucht es dafür zuerst eine lange Phase traditionsgebundener Forschung. Warum dann überhaupt bewerten? Anstatt des peer-review Systems, in dem Wissenschaftler:innen andere Arbeiten bewerten, fordern radikale Stimmen eine Lotterie. Schon jetzt entscheidet der SNF bei qualitativ gleich eingeschätzten Projekteingaben mit dem Los. Die Ausweitung eines solchen Systems würde Stress reduzieren und die Antragsteller:innen von dem Druck befreien, ihr Gesuch möglichst gut zu verkaufen. Das hiesse mehr Zeit für die Forschung, sowohl traditionell wie auch innovativ.
Text Maximilian Mosbacher
Illustration Maria Klimowa
Zusätzliche Informationen
Park, Michael, Erin Leahey, and Russell J. Funk. „Papers and patents are becoming less disruptive over time.“ Nature 613.7942 (2023): 138-144.
Bloom, Nicholas, et al. „Are ideas getting harder to find?.“ American Economic Review 110.4 (2020): 1104-1144.
Kuhn, Thomas S. The structure of scientific revolutions. University of Chicago press, 2012.
Wang, Jian, Reinhilde Veugelers, and Paula Stephan. „Bias against novelty in science: A cautionary tale for users of bibliometric indicators.“ Research Policy 46.8 (2017): 1416-1436.
Fortunato, Santo, et al. „Science of science.“ Science 359.6379 (2018): eaao0185.