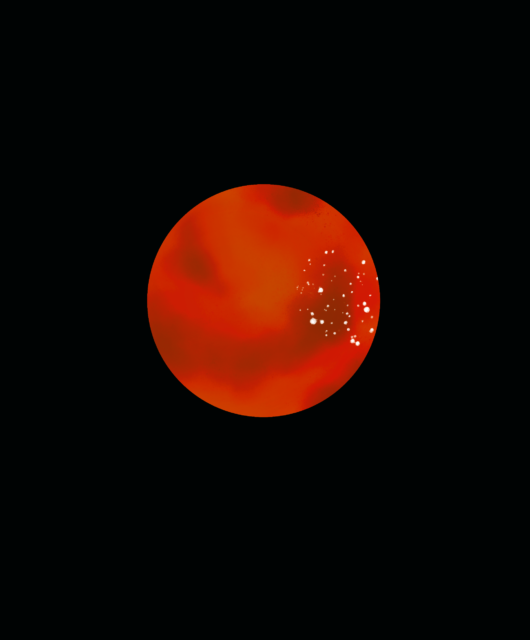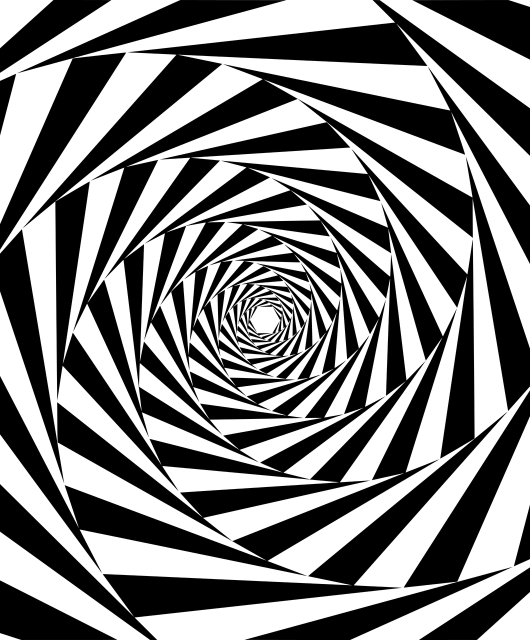Eine Geige war das Einzige, was mir von meinem Vater nach seinem Verschwinden blieb.
Geigenbauer – das war er gewesen und so hatten ihn auch die Leute aus dem Dorf genannt. Vater hatte viele Spitznamen gehabt, aber «Geigenbauer» war der netteste von allen gewesen.
Ich habe ihn als besonderen Mann in Erinnerung behalten. Er hatte schiefergraue Locken und den Kopf voller wilder Geschichten. Wenn er nicht musizierte oder an einer neuen Geige zimmerte, erzählte er Geschichten. Ich hing an seinen Lippen, sog jedes Wort, das er sprach, in mich auf. Mutter warnte mich, sagte, ich solle ihn nicht allzu ernst nehmen. Stattdessen nahm ich sie nicht ernst. Erst später wurde mir klar, dass mein Vater nicht mehr zwischen Wahrheit und Fiktion hatte unterscheiden können. Für ihn verschwammen die Grenzen. Mit einem Fuss lebte er hier – bei Mutter und mir – und mit dem anderen in seiner Fantasie.
Mein Vater war mit der Geige in der Hand aufgewachsen. Nach dem Abendessen spielte er für Mutter und mich, während wir das Geschirr vom Tisch räumten und unter einem lauwarmen Wasserstrahl abspülten. Dabei konnte er nie stillstehen. Manchmal tanzte er mit der Geige unter dem Kinn durch das Wohnzimmer, bis die Kerzenständer zitterten. Trotzdem verspielte er sich nie. Das Instrument schien Teil seines Körpers zu sein.
Vater roch nach Holz und Schweiss und Wein. Ich verbrachte Stunden in der Werkstatt, beobachtete ihn bei seiner Arbeit. Er verstand sein Handwerk. Auch das sagte man sich im Dorf. Da unten wurde viel über meine Familie getuschelt. Nach wie vor tratscht man über uns, obwohl er gar nicht mehr da ist.
Eines Herbstmorgens, an dem dicker Nebel durch die Strassen kroch, weiss wie Milch, war mein Vater einfach weg. So wie seine durchgetretenen Lederschuhe, der lehmgrüne Mantel und die Schiebermütze. Er war weg und kam nicht wieder. Tage verstrichen, Wochen und schliesslich Jahre. Niemand weiss, wo er ist. Ob er noch lebt oder nicht.
Mutter reagierte gefasst. Sie machte weiter wie bisher: ging zur Arbeit, kümmerte sich um den Haushalt, las bei flackerndem Kerzenlicht die Tageszeitung, bis sie einnickte. Ich denke, dass sie geahnt hatte, er würde uns verlassen. So wie sie fühlen konnte, wenn ein Sturm im Anmarsch war. Dann kribbelten ihre Ohrläppchen. Ich denke, sie hatte es gespürt und sein Verschwinden doch nicht verhindert – und so ganz verzeihen konnte ich ihr das nie.

Meine Eltern gaben ein merkwürdiges Paar ab. Sie passten überhaupt nicht zueinander. Mutter war ganz anders als Vater. Zwei tiefe Falten umklammerten ihren Mund. Sie war ernst und still, sprach nur das Nötigste. Im Dorf galt sie als vernünftige Frau. Die einzige unvernünftige Entscheidung, die sie je getroffen habe, sei, meinen Vater geheiratet zu haben – wieder so eine Meinung, die man im Dorf antraf. Natürlich habe ich mich als Kind oft gefragt, wie sich die beiden kennengelernt hatten. Meine Eltern lieferten mir keine befriedigende Antwort. Vater tischte mir jedes Mal eine andere Geschichte auf und Mutter erzählte bloss: «Er hat mich gefragt, ob ich mit ihm tanzen wolle. Ich habe Ja gesagt. Ein Jahr später hat er mich gefragt, ob ich ihn heiraten wolle. Und ich habe Ja gesagt.»
Die Wahrheit muss wohl irgendwo dazwischen liegen. Ich male sie mir so aus:
Eine Tanzveranstaltung im Gemeindehaus. Mutter steht im Abseits, im Schatten, lauscht der Musik, weil sie nicht genug Mut zusammenkratzt, sich den Tanzenden anzuschliessen. Ihre Augen liegen auf Vater, der sich etwas unbeholfen bewegt, doch so voller Leidenschaft, und sich nicht darum kümmert, dass einige der Anwesenden über ihn lachen. Aber er bemerkt Mutter – die damals ja noch nicht Mutter war, sondern eine junge Frau – er bemerkt sie und lächelt sie an. Und dann geht er auf sie zu und fordert sie zum Tanzen auf.
Diese Vorstellung gefällt mir und ich halte an ihr fest.
In seiner Werkstatt hatte Vater eine Geige zurückgelassen. Die letzte, an der er gearbeitet hatte. Er hatte sie für mich gemacht. Nach seinem Verschwinden hörte ich jedoch mit dem Geigespielen auf. Mutter überredete mich einmal, mit ihr zur Musikschule in die Stadt zu fahren, für eine Probestunde. Die Lehrerin war alt und streng und sie lachte nicht. Wir kamen nicht miteinander zurecht. Danach stand die Geige jahrelang unberührt in unserem Wohnzimmer und erinnerte mich an meinen Vater. Über die Zeit wuchs neben der Trauer in mir Wut heran. Eines Tages ertrug ich den Anblick der Geige nicht mehr, griff grob nach ihr und schmetterte sie gegen die Wand. Einmal, zweimal, dreimal – so lange, bis ich nur noch den filigranen Hals in den Händen hielt. Um mich herum kastanienbraune Holzsplitter. Ich liess mich auf den Boden sinken, presste die Überreste der Geige an mich und starrte vor mich hin. Tränen waren keine da. Dann sah ich auf. Mutter stand im Türrahmen. Ihre Lippen zeichneten einen Brückenbogen nach. Sie sagte meinen Namen.