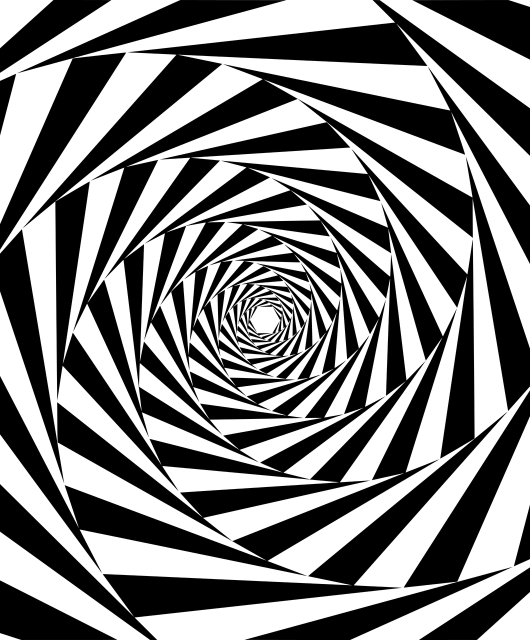Plötzlich ist es Zeit zu gehen. Ich bin die letzte Gästin auf der Party: schon viel zu lange da, aber keinen Bock zu gehen. In sieben Semestern kann man sich in eine Stadt verlieben. Selbst in ein Dorf wie Fribourg. Die Gastgeberin tritt neben mich auf den Balkon: ich mit Zigi, sie mit Zahnbürste. Oder war das umgekehrt?
Es fällt der erste Schnee der Saison auf die Bahngleise. Es ist Nacht und es ist Winter und es ist Zeit zu gehen. Der Glühwein klebt kalt an der Kelle. Ich erinnere mich an meine erste Tasse Glühwein im Centre Fries. Das ist schon Jahre her, da gab es die Fries-Katze noch nicht. Ich runzle die Stirn: Vielleicht ist das mit der Fries-Katze auch schon wieder vorbei. Damals wohnte ich in der Grand-Rue, im Schatten der Kathedrale. Von da aus war es im Sommer nicht weit in die Motta oder ans Ufer der Saane. Ab und zu trafen wir uns auf ein Bier oder einen Spritz auf der Terrasse des Le Port. Dort blühte das Gemüse wie Blumen in den Töpfen.
Sieben Semester ist nicht gerade eine Ewigkeit, aber zwischendurch wirkte es so. Zum Beispiel, wenn ich während meinen Zoom-Vorlesungen die Tauben auf der Dachschräge meiner Mansardenwohnung scharren hörte. Ich schrieb mit rosa Filzstift auf einen Zettel Nec spe, nec metu und klebte ihn an die Wand über meinem Schreibtisch. Ein Professor hatte dieses Zitat in seiner Vorlesung erwähnt. Ohne Hoffnung, ohne Furcht.
«Was willst du damit sagen?», fragt mich die Gastgeberin.
Sie ist zu höflich. Will nicht sagen, es sei Zeit zu gehen. Schon halb vier ist es, morgen um Viertel nach zehn hat sie Rechtsgeschichte in der Miséricorde. So wie alle letzten Gäst*innen, stelle ich mich dumm.
«Ich meine nur.»
Ich bin betrunken. Könnte kotzen, weil die Stadt im Schnee so schön aussieht. Wie einem Märchen entsprungen. Ich meine nur, dass ich mit jeder Ecke in dieser Stadt eine Erinnerung verbinde. Der Kiosk im Beauregard, wo mich der Besitzer kennt. Kaffee im Pappbecher auf dem Flohmarkt. Lange Gespräche mit dem Velohelm schon auf. Ich meine nur: Bin ich hier nicht zuhause?
«Irgendwie schon», sagt sie und bringt ein paar schmutzige Gläser in die Küche. Sie muss es nicht verstehen. Manche Leute haben Glück: Heimat ist da, wo sie geboren wurden. Ich erzähle das mit dem Kiosk, dem Kaffee, dem Velohelm. Anderes behalte ich für mich. Für das Eigentliche finde ich sowieso keine Worte. Irgendwann liegt an keinem Ende keiner Zugstrecke noch ein Kinderzimmer. Irgendwann bleibt auch von der Mansardenwohnung nichts als ein Zettel. Irgendwann ist es Zeit zu gehen.
Ich schnüre meine Schnürsenkel im Treppenhaus. Die Gastgeberin lehnt im Bademantel im Türrahmen. Gerne würde ich ihr sagen, sie soll Fribourg für mich geniessen. Gerne würde ich es euch allen sagen: Geht im Fri-Son tanzen und im Galterntal spazieren! Wisst ihr denn nicht, dass unter der Universität früher ein Friedhof lag? Aber das Weggehen ist so anders als das Bleiben. Und ich bin mindestens drei Tassen Glühwein zu betrunken für diesen Scheiss. Also gehe ich schlafen. Und noch während ich durch den Neuschnee vor dem Haus stapfe, höre ich vom Balkon über mir eine Stimme: «Schreib mir, wenn du zuhause bist.»