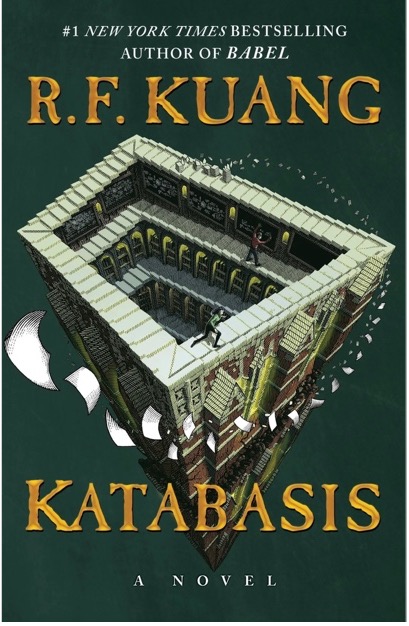Eben erst erschienen, schon wird der neueste Bärfuss von der Kritik gefeiert und ist für den Leipziger Buchpreis nominiert. Warum mich Hagard jedoch weder aufwühlt noch begeistert, sondern nervt.
Philips Leben nimmt eine ungeahnte Wendung, als er am Bellevue spontan beschliesst, einem Paar Ballerinas aus pflaumenblauem Kalbsleder, genauer gesagt ihrer Trägerin, zu folgen. Ab diesem Zeitpunkt ist seine Welt nicht mehr dieselbe. Philip verfolgt die unbekannte junge Frau, der Erzähler folgt Philip. Eben noch als selbstständiger Liegenschaftsentwickler tätig und zu einem geschäftlichen Treffen verabredet, scheint er die Gesellschaft plötzlich nicht mehr von innen heraus, als ein Teil von ihr, sondern von aussen zu betrachten und zu interpretieren. Zu Beginn ist es für Philip wie ein Spiel; er erwägt, die Frau anzusprechen. Doch dazu kommt es nie. Der Zufall oder das Schicksal funkt stets dazwischen und weiss ein Aufeinandertreffen gekonnt zu verhindern. Philip spürt, dass es zwischen ihm und der Frau eine Art übernatürliche Verbindung geben muss: «Seine Existenz hing an einer anderen Existenz. Es spielte keine Rolle, wer sie war, was sie wollte, solange er sie nicht verlor, würde er nicht verloren sein.» Vieles in Hagard bleibt verwirrend und ungewiss. So bleibt unklar, was Philip antreibt, ob er verzaubert, verliebt oder rasend ist. Noch zu Beginn der Verfolgung meint er, in diesen wenigen Stunden so viel gelernt zu haben wie noch nie und darum jetzt einen neuen Sinn in seinem Leben zu sehen, weshalb er sich nicht mehr mit den anderen Menschen um ihn herum identifiziert: «Gestern war er einer wie sie, heute verachtet er die Menschen.» Am Ende will er jedoch, anders als Peter Stamms Thomas und andere Ausreisser, in sein altes Leben zurückkehren. Leider wird aus der Verfolgungsjagd quer durch Zürich zwischendurch ein Warten in Zürich. Philip muss die ganze Nacht vor dem Haus der Frau ausharren, denn sie geht nachts schlafen. Man leidet wie Philip, denn das Warten zieht sich.
Zu Beginn gibt man Bärfuss eine Chance, überliest grosszügig die philosophischen Abhandlungen und zahlreichen altklugen Bemerkungen, damit endlich die eigentliche Geschichte beginnen kann. Und diese Geschichte selbst ist gut, spannend und fesselnd, die zweifache Verfolgung vermag den Leser in den Bann zu ziehen – solange erzählt wird. Dazwischen verläuft sich Bärfuss aber in langatmige Abstecher, die jedoch erfreulicherweise nicht so lange dauern wie die Kolonialgeschichte Australiens in Koala. Noch nerviger ist, dass Bärfuss nichts beim Namen nennt, sondern alles nur äusserst deutlich andeutet. Dieses Umschreiben wirkt irgendwann lächerlich. Anstatt die Dinge beim Namen zu nennen, gibt er sich die grösste Mühe, mit neuen Begriffen aufzukommen: Smartphones sind «kluge Telefone» und Flyer «Wurfprospekte»; Yoga praktizieren wird zu «sich durch die Übungen einer fernöstlichen Religion ertüchtigen» und der Businessman, Feind aller linken Literaten, heisst «Dachs mit Polyesterkrawatte». Bärfuss schreibt um den heissen Brei herum. Das macht den Roman jedoch nicht künstlerisch, sondern künstlich, wirkt unpassend und gesucht. Irgendwann nervt auch das aufgesetzte Spiel mit Vorurteilen – Inder stinken, Griechen arbeiten nicht (oder wann denn endlich mal?), Türken trinken dieses «Gesöff» namens Ayran, «das Billigste im Kühlschrank», doch tatsächlich freiwillig – Philip kriegt es fast nicht runter.
Im Erzählton wechselt Bärfuss zwischen gestelzten Phrasen und Absätzen in reiner Umgangssprache, zwischen poetischen, teils religiös angehauchten Lobpreisungen der Morgenstimmung und vulgärem Fluchen. Schliesslich lässt er Philip geradezu liebevoll mit seinem neu erworbenen Plüschtierschuh sprechen, da er auf der Flucht vor Kontrolleuren seinen linken Timberland im Zug verloren hat.
Bärfuss ist kein Hasenfuss, er kritisiert die weltweiten Folgen von Industrialisierung und Globalisierung und prangert an: «Alles in allem hatte der Pragmatismus, der das Denken beherrschte, auch die Liebe versachlicht.» Insgesamt ein pessimistischer Entwurf der Gesellschaft des einundzwanzigsten Jahrhunderts, das von Krisen, Unsicherheit und der zukunftslosen Zielstrebigkeit der Menschen geprägt ist. Hagard ist in diesem Sinne ein Roman über das Grauen der Welt – und über das Grau von Zürich: Alles in Bärfuss’ Welt scheint zu vermodern, ist stinkig und ekelhaft; der Leser wird entfernt an Süskinds Beschreibung vom Paris des achtzehnten Jahrhunderts erinnert.
Der Titel scheint extra so gewählt zu sein, dass man ihn als Leser nicht versteht und erst in einem Französischwörterbuch oder im Deutschen Jagdlexikon nachschlagen muss. Oder aber man wartet auf ein Interview mit Bärfuss, in dem er sich dazu bereiterklärt, einen über seine Titelgebung aufzuklären: Hagard ist ein Jagdvogel – Philip jagt die unbekannte Frau, der Erzähler jagt Philip beziehungsweise seiner Geschichte nach.
Hagard lässt mich genervt zurück. Nach abgeschlossener Lektüre brauche ich dringend einen Schluck Ayran, um den unangenehmen Nachgeschmack loszuwerden, den Bärfuss hinterlassen hat.