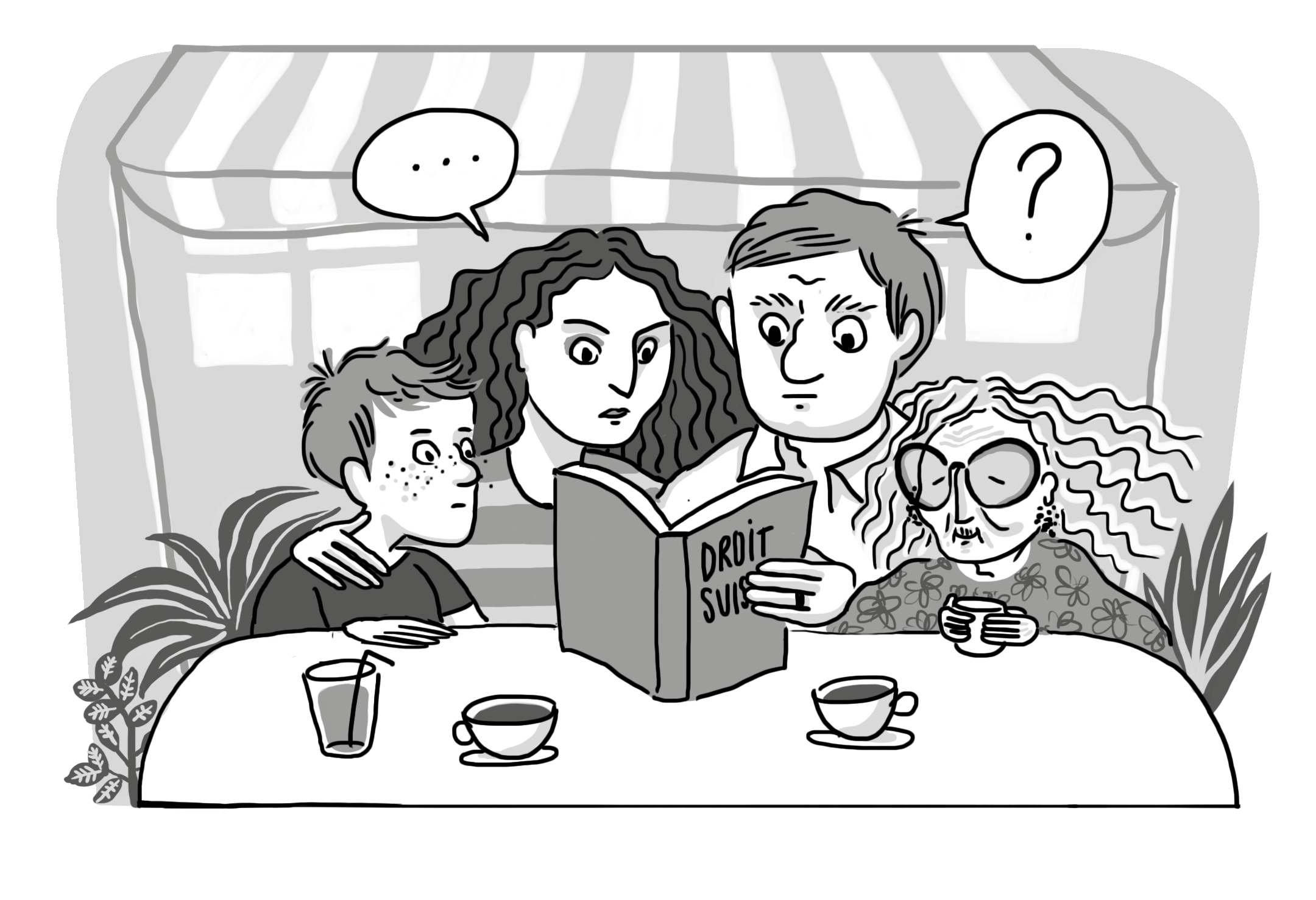Sex. Überall. Im Alltag und in den Medien ist er so präsent wie noch nie. Einerseits mag diese Entwicklung äusserst befreiend sein, kann jedoch auch zu starkem Leidensdruck führen.
Vorbei sind die Zeiten, als sich Sexualität nur hinter verschlossenen Türen abspielte. Vielmehr ist sie nun Thema in Filmen, Musik, Literatur, Werbung – ja, wo denn eigentlich nicht? Diese Enttabuisierung ist auch in der Entwicklung des „Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders“ (DSM) zur Diagnose psychischer Störungen zu erkennen. Im Vergleich zu den früheren vier Auflagen wurde im aktuellen DSM-5 einiges gelockert. Sexuelle Präferenzen, die nicht der „Norm“ entsprechen, gelten nicht mehr unbedingt als psychische Störungen, der Normbegriff ist nun breiter gefächert. So war etwa Homosexualität 1952 in der ersten Auflage des DSM noch in der Kategorie „Sexuelle Abweichungen“ zu finden.
Leidensdruck statt Entspannung
Mit dem DSM-5 werden auch sexuelle Funktionsstörungen klassifiziert. Diese können in unterschiedlichen Phasen der sexuellen Interaktion vorkommen, wie etwa während der Lustentwicklung, der Erregung oder während des Orgasmus. Vornherein und ganz wichtig: Eine solche Störung wird erst diagnostiziert, wenn dadurch deutlicher Leidensdruck oder interpersonelle Schwierigkeiten entstehen. Frauen leiden dabei am häufigsten an Orgasmusschwierigkeiten und Störungen mit sexuell bedingten Schmerzen, Männer dagegen an Erektionsstörungen. Die Ursachen dieser Probleme können sehr verschieden sein, sind jedoch meist psychischer Natur. Oft entstehen sie mittels Lernprozessen: Treten einmal Schwierigkeiten auf, kann das zu Erwartungsängsten führen. Die Angst vor Misserfolg nimmt zu, weshalb es zu einer Konditionierung der Angstreaktion kommen kann. Dies hat zur Folge, dass daraufhin viele zunehmend intime Situationen umgehen, wodurch keine positiven sexuellen Erfahrungen mehr erlebt werden – das Problem festigt sich.
Was ist denn schon normal
Sexuellen Funktionsstörungen stellen eine Seite der Sexualität dar, die meist verschwiegen bleibt. Wie bereits angesprochen ist heutzutage der Umgang mit dem Thema so offen wie noch nie. Jedoch werden dabei meist nur die positiven Aspekte beleuchtet: Sex geht immer, ist spektakulär, geil, was auch immer, auf jeden Fall nicht schlecht. Doch genau dadurch kann die eigentlich so befreiende Enttabuisierung der Sexualität zu einem enormen Leistungsdruck führen und so sexuelle Funktionsstörungen zusätzlich verstärken oder entstehen lassen. Weiter kann dadurch der Eindruck erweckt werden, dass die eigene Sexualität nicht „normal“ sei. Doch was ist dabei denn überhaupt normal? Normale Sexualität in dem Sinne ist in erster Linie befriedigend, ob alleine, zu zweit oder zu mehreren. Sie zeichnet sich aus durch Vielseitigkeit, ein breites Verhaltensrepertoire während dem Sex und durch eine offene Kommunikation darüber was gefällt und was nicht. Eine genaue Definition ist jedoch schwierig. Einfacher ist zu bestimmen, was nicht normal ist, und das ist eben alles, was mit Leidensdruck verbunden ist.
Entspannt euch mal
Wurde nun einmal eine sexuelle Funktionsstörung entwickelt, gibt es zur Behandlung unterschiedliche Therapieformen mit guten Erfolgsaussichten. So kann nach nicht allzu langer Zeit die eigene Sexualität wieder oder überhaupt zum ersten Mal „normal“ ausgelebt werden. Damit das dann auch so bleibt oder gar nicht erst Leidensdruck entsteht, ist ein entspannter Umgang mit Sexualität wichtig: Sich klar zu werden, dass deren mediale Darstellung in vielen Fällen nicht echt ist, trägt dazu bei. So etwa auch ein positiver Zugang zum eigenen Körper und Selbsterfahrung, sprich selbst zu wissen, was einem guttut. Denn schlussendlich ist Sex ja die schönste Nebensache der Welt, die in keinem Fall vernachlässigt werden sollte.
Credit Illustration: Daniel Morgan