Kurz vor der Abstimmung über die Konzernverantwortungsinitiative scheint deren Ausgang immer noch ungewiss. Kein Zufall also, dass die Ethnologin Ellen Hertz ihre Forschung zu diesem Thema präsentiert.
Aufgewachsen in den USA lebt und arbeitet Ellen Hertz nun schon jahrzehntelang in der Schweiz. Bei ihrer Arbeit als Professorin an der Universität Neuenburg beschränkt sie sich aber nicht auf Forschung und Lehre: Sie gibt im Fernsehen Expertenmeinungen ab, moderierte einen Ted-Talk und war im Schweizerischen Wissenschaftsrat. Mindestens so interessant wie ihre Person ist aber die sozialwissenschaftliche Forschung, der sie nachgeht. Im Rahmen eines Soziologiekurses sprach sie darüber, warum das Schweizer Governance-Modell im Umgang mit Unternehmen nicht reicht.
Gesellschaftlicher Wandel
Zur Erinnerung: Am 29. November, diesen Sonntag, stimmt das Schweizer Stimmvolk über die Konzernverantwortungsinitiative ab. Sie fordert, dass Schweizer Unternehmen, die im Ausland Tochterunternehmen kontrollieren, für deren Menschenrechts- oder Umweltverletzungen in der Schweiz haftbar gemacht werden können. Kann das Schweizer Unternehmen aber beweisen, dass es seine ausländischen Partner den vorgegebenen Sorgfaltsprüfungen unterzogen hat, ist es nicht haftbar.
Wie konnte das Bedürfnis nach einer solchen Initiative überhaupt erst entstehen? Ellen Hertz setzt bei ihrer Erklärung Ende der 1970er Jahre an. Das kapitalistische Wirtschaftssystem schuf zu der Zeit immer komplexere Produktions- und Liefernetzwerke. Grossunternehmen wie Nestlé verlagerten ihre Produktion vermehrt ins Ausland. Ihre Produkte wurden somit meist im Globalen Süden unter schwächer reglementierten Arbeitsbedingungen produziert, aber zu einem Grossteil in Industrieländern konsumiert. Um öffentliche Kritik kamen die Unternehmen deshalb nicht herum. Man denke beispielsweise an Nestlés Skandal um Milchpulver Mitte der 70er Jahre.
Die OECD wurde sich des Problems vergleichsweise früh bewusst. 1976 veröffentlicht sie erstmals Leitsätze für multinationale Unternehmen, die Staaten dabei unterstützen sollen, ihre eigene Rechtssysteme entsprechend anzupassen. Für Unternehmen sind sie gleichzeitig Empfehlungen, wie sie Arbeitsbedingungen schaffen können, die im Einklang mit den Menschenrechten stehen. Empfehlungen, versteht sich. In dieselbe Kerbe schlägt die 1977 erschienene Grundsatzerklärung über multinationale Unternehmen und Sozialpolitik der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO).
Solche Bestrebungen, so Ellen Hertz, wären schlichtweg nicht möglich gewesen ohne die Arbeit von Nichtregierungsorganisationen, Kirchen und Gewerkschaften, die beispielsweise durch Boykotts Druck auf Marken wie Nestlé aufbauten. «Gesellschaftlicher Wandel entsteht durch soziale Bewegungen. Er ist nicht der natürliche Lauf der Dinge», sagt die Sozialwissenschaftlerin.
Symptombehandlungen
Und die Antworten der Konzerne? Ob «Sustainability Programs» oder «Corporate Citizenship»; Namen gab es verschiedene, die Idee war überall ein ähnliche: Corporate Social Responsibility (CSR). Die Unternehmen gaben sich eigene Vorschriften, um Arbeits- und Umweltbedingungen innerhalb ihrer Produktions- und Liefernetzwerke zu kontrollieren – Standards, die in Kollaboration mit der ILO oder NGOs ausgearbeitet wurden.
An diesem Punkt setzt die empirische Forschung von Ellen Hertz an. In China, Hong Kong und Taiwan begleitete sie Verantwortliche von CSR-Programmen, vorwiegend im Elektronik-Sektor. «Obwohl die Programme Probleme aufwerfen, sind sie besser als nichts», sagt Hertz. Ihre Analyse: Die Selbstregulierung der Unternehmen hat schlichtweg Grenzen. Am deutlichsten werden diese Grenze beim Widerspruch, der zwischen ökonomischen und sozialen Bemühungen entstehen kann: Eine Marke XY verlangt von ihrer Fabrik im Ausland viel und schnell zu produzieren. Gleichzeitig aber sollen Menschenrechts- und Umweltstandards eingehalten werden. Oft ist dies faktisch nicht machbar – es fehlen Ressourcen.
Eine andere Möglichkeit der Selbstregulierung in Unternehmen ist es, vor Ort Programme zu kreieren, die mit den eigentlichen Produktionsbedingungen nichts mehr zu tun haben. Ein Beispiel aus Hertz’ Feldforschung in einem chinesischen Dorf im Landesinnern: Während ihre Eltern in Fabriken an der Küste arbeiten, leben Kinder in Internaten und werden von ihren Grosseltern versorgt. Die Familien sehen sich ein paar Mal im Jahr. Das CSR-Programm, das in der Region in die Wege geleitet wurde, sah folgendermassen aus: Damit die Kinder mit ihren Eltern in Kontakt bleiben konnten, stellte man ihnen Smartphones zur Verfügung. So ein Projekt macht sich gut im Jahresbericht, der den Aktionären präsentiert wird, ändert aber nichts an den Arbeitsverhältnissen.
Und die Schweiz?
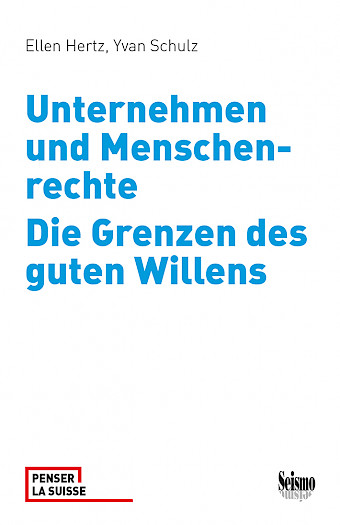 Während Ellen Hertz’ Vortrag wird trotzdem immer wieder klar: Eine Einteilung in «gute» und «böse» Konzerne ist nicht nur unwissenschaftlich, sondern auch schlicht nicht zielführend, möchte man die von ihr angesprochenen Grenzen der Selbstregulierung untersuchen. Leitprinzipien der Vereinten Nationen zur Governance in diesem Bereich gehen in die Richtung einer «sinnvollen Mischung» («Smart Mix»). Gemeint ist damit die Kombination von oben umrissenen Selbstregulierungsmassnahmen der Unternehmen, einschränkendem Staatsrecht sowie dem Zugang zu Gerichten für Opfer. Hertz ordnet ein: «Das Schweizerische Governance-Modell beruht derzeit ausschliesslich auf der Selbstregulierung der Unternehmen und dementsprechend nicht auf dem «Smart Mix», der von den UN-Leitprinzipien vorgegeben ist.» Die Konzernverantwortungsinitiative versuche diesen Umstand zu korrigieren. Denn, so Hertz: «Es gibt derzeit kein Gesetz, mit dem man Tochterfirmen Schweizer Unternehmen im Ausland für Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden belangen kann.»
Während Ellen Hertz’ Vortrag wird trotzdem immer wieder klar: Eine Einteilung in «gute» und «böse» Konzerne ist nicht nur unwissenschaftlich, sondern auch schlicht nicht zielführend, möchte man die von ihr angesprochenen Grenzen der Selbstregulierung untersuchen. Leitprinzipien der Vereinten Nationen zur Governance in diesem Bereich gehen in die Richtung einer «sinnvollen Mischung» («Smart Mix»). Gemeint ist damit die Kombination von oben umrissenen Selbstregulierungsmassnahmen der Unternehmen, einschränkendem Staatsrecht sowie dem Zugang zu Gerichten für Opfer. Hertz ordnet ein: «Das Schweizerische Governance-Modell beruht derzeit ausschliesslich auf der Selbstregulierung der Unternehmen und dementsprechend nicht auf dem «Smart Mix», der von den UN-Leitprinzipien vorgegeben ist.» Die Konzernverantwortungsinitiative versuche diesen Umstand zu korrigieren. Denn, so Hertz: «Es gibt derzeit kein Gesetz, mit dem man Tochterfirmen Schweizer Unternehmen im Ausland für Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden belangen kann.»
Ellen Hertz’ Forschung verfolgt einen klaren wissenschaftlichen Anspruch. Trotzdem, oder gerade deshalb, lassen sich aus ihr Meinungen ableiten.






