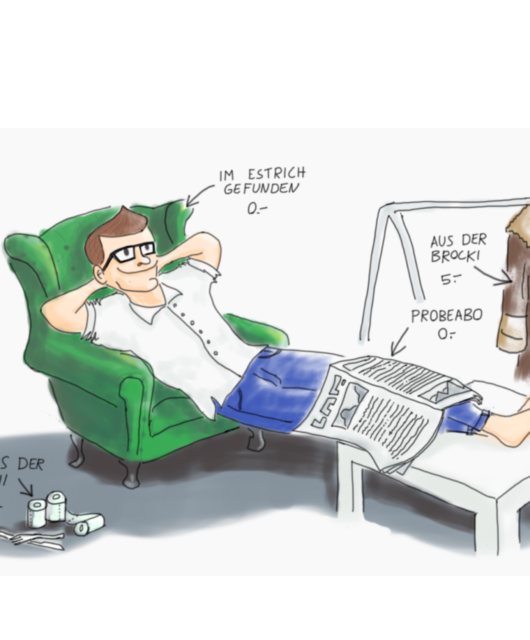Spectrum besucht die psychologische Beratungsstelle der Uni Freiburg und spricht mit Jean Ducotterd über Krisen und deren Auswirkungen sowie Chancenpotential.
Jean Ducotterd, sie sind Psychologe bei der psychologischen Beratungsstelle an der Uni Freiburg. Wie lange arbeiten Sie hier schon und an wen darf man sich sonst noch wenden?
Ich arbeite hier seit etwas mehr als fünfzehn Jahren und wir, meine Kollegin Rita Rämy und ich, betreuen Universitätsangehörige, vor allem Studierende. Frau Rämys Muttersprache ist Deutsch beziehungsweise Schweizerdeutsch und meine ist Französisch. Wir sprechen beide auch die jeweils andere Sprache und zusätzlich Englisch, sodass unsere Beratungen möglichst für alle zugänglich sind. Zudem haben alle die Möglichkeit, sich entweder von einer Frau oder einem Mann betreuen zu lassen.
Mit welchen Anliegen kommen die Studierenden und andere zu Ihnen?
Wir teilen die Patienten und Patientinnen grob in drei Gruppen ein: Menschen, die im Studium Schwierigkeiten haben, etwa mit Arbeitstechniken, Lernstrategien oder Prüfungsangst. Dann Leute, die mit Beziehungsschwierigkeiten zu uns kommen, Beziehung im Sinne von Partnerschaft, interfamiliäre Beziehungen, Beziehungen mit Freunden, aber auch Beziehungen in der Wohngemeinschaft sowie Beziehungen von Studierenden mit den Dozierenden und den Professorinnen und Professoren. Und zuletzt Menschen, deren psychologische Gesundheit zu thematisieren ist. Bei der letzten Gruppe sind wir therapeutisch orientiert, bei den beiden ersteren bieten wir Beratungen oder sogenannte Coachings an. Im Schnitt werden wir etwa zu drei Fünfteln von Frauen und zu zwei Fünfteln von Männern besucht.
Aus welchen Bereichen stammen die Patientinnen und Patienten?
Ein grosser Teil unserer Besucherinnen und Besucher kommen aus den geisteswissenschaftlichen Fächern. Innerhalb der Geisteswissenschaft gibt es tendenziell einen höheren Anteil aus der Psychologie und der Anthropologie. Ich denke, das ist ziemlich natürlich, da sich solche Menschen mehr mit sozialen und psychologischen Themen auseinandersetzen. Ganz allgemein lassen sich die Beratungssuchenden proportional zu den Anteilen Studierender in den verschiedenen Fächern vergleichen. Mehr Jurastudierende heisst mehr Patientinnen und Patienten aus diesem Bereich. Pro Jahr betreue ich zwischen hundert und 150 Patientinnen und Patienten und Frau Rämy etwa nochmals so viele. Neunzig Prozent der Besucherinnen und Besucher sind Studierende und etwa zehn Prozent Doktorierende. Manchmal gibt es auch Professorinnen oder Professoren, die uns aufsuchen, oft nicht für eine spezifisch persönliche Beratung, sondern um sich Rat für die Teamführung zu holen – eine Supervision also. Sie haben Fragen darüber, wie sie mit den Studierenden oder mit den Doktorierenden umgehen sollen.
Wir wollen heute allgemein über persönliche Krisen sprechen. Was ist eine Krise?
Eine Krise ist ein Moment, in dem ein Mensch in seinem Innern völlig unaufgeräumt ist, es besteht ein Ungleichgewicht zwischen drei miteinander verknüpften Bereichen: den Emotionen, der Rationalität und den Gefühlen. Es wird stark emotional oder stark rational betont reagiert, ohne dabei auf die Gefühle zu hören. Meist sind solche Krisen mit Stress verbunden. Die Stressoren, also die Faktoren, die Stress auslösen, sind etwa Leistungsdruck während des Studiums, Konflikte in sozialen Gruppen, Trennungen, Familienprobleme oder natürlich Gesundheitsprobleme wie psychiatrische Krankheiten.
Also sollten wir Krisen ausweichen?
Nein, Krisen haben eine Funktion, sie sind Entwicklungsmomente. Die Schwierigkeit für Studierende ist, dass sie Krisen oft alleine durchleben und bewältigen. Oft fehlt ihnen der Rückhalt, den sie in ihrer ursprünglichen Umgebung im Elternhaus genossen. Kommt hinzu, dass die Menschen, an welche sich Studierende dann wenden, oft Gleichaltrige sind. Es fehlen Gesprächspartner, die Ähnliches bereits erlebt haben, die ihnen durch den Austausch eigener Erfahrungen helfen könnten.
Oft drücken sich Krisen durch Ängste aus. Wie können wir auf die Angst reagieren?
Ängste sind nichts Schlechtes, sie sind Abwehrmechanismen, die einen Sinn haben und einen Zweck erfüllen. Aber gerade in einer Krise werden Gefühle so erlebt, als seien sie anormal. Wir möchten ihnen entfliehen, sie meiden. Wir möchten unsere Emotionen nicht konfrontieren. So geraten wir in ein defensives Verhalten und ziehen uns zurück.
Können Sie ein Beispiel nennen?
Ein Student, der zu mir kam, hatte Angst, seinen Eltern gegenüber zuzugeben, dass er durch eine Prüfung gefallen war. Er verschob die Beichte, in der Hoffnung, bei der Wiederholung die Prüfung zu bestehen und dann die ganze Geschichte erzählen zu können. Das ging jedoch schief, er fiel wieder durch und erhielt einen definitiven Fehlversuch, konnte also den Bachelor nicht abschliessen. Die Angst steigerte sich immer mehr und er mied schlussendlich die Eltern vollständig, sprach gar nicht mehr mit ihnen. Der Student wusste nicht, wie er die Angst überwinden könnte. Theoretisch ist es einfach, wir können bei einer Angst entscheiden, vor ihr zu fliehen oder die Konfrontation zu suchen. In diesem Fall wäre es wohl sinnvoll, die Kommunikation mit den Eltern weiterzuentwickeln und einen Weg zu suchen, über die unangenehme Situation zu sprechen.
Gibt es noch andere Symptome?
Ich hatte bereits Patientinnen und Patienten hier, die bei ihrer „Flucht” vor den Gefühlen ein grosses Risiko eingingen, statt sich tatsächlich mit dem realen Problem auseinanderzusetzen. Patienten und Patientinnen, die deshalb täglich den Sexualpartner wechselten. Andere flüchten sich in eine Sucht – bei Studierenden ist es typischerweise die Spielsucht, damit meine ich Onlinegames oder ähnliches. Meist fördert die ursprüngliche Umgebung das spezifische Fluchtverhalten, also die Beschaffenheit im Elternhaus und was wir dort gelernt haben.
Merken die Betroffenen, dass sie sich in einer Krise befinden?
Absolut nicht. Erst dann, wenn die Krise so gewaltig ist, dass etwa Veranstaltungen an der Universität gemieden werden. Dann entstehen Probleme, die nicht mehr ignoriert werden können, weil die Studierenden durch die Prüfung fallen.
Die Krise wird erst dann bemerkt, wenn wir mit ihr im Leben konfrontiert werden?
Oder wenn wir sehr intensiv leiden. Ich habe zum Beispiel viele Gespräche mit Kollegen und Kolleginnen über Ernährungsprobleme geführt. Viele Studierende, oft Frauen, die ein krankhaftes Essverhalten entwickeln, ändern ihr Verhalten nicht, bis zu dem Punkt, an dem der Leidensdruck gross genug ist. Und das kann sehr weit gehen.
Wie gelingt uns eine gesunde Konfrontation mit unserer Angst?
Idealerweise in einer ersten Phase durch eine Analyse. Gespräche mit anderen helfen uns, unsere Situation besser zu verstehen. Das banale Verständnis reicht nicht aus. Wir lernen, was eine Emotion uns mitteilt. Angst sagt mir: Vorsicht, hier könnte etwas geschehen! Wenn wir verstehen, warum wir ein bestimmtes Gefühl erleben, gewinnen wir die Möglichkeit, eine Verhaltensänderung anzusteuern und uns weiterzuentwickeln.
Ist das der Weg aus einer Krise heraus?
Ja, auch bei Trennungen. Hier ist die überwiegende Emotion die Trauer. Die Betroffenen durchleben einen Trauer- beziehungsweise Abschiedsprozess. Auch vor der Trauer können wir fliehen, sie verdrängen und die Auseinandersetzung mit ihr meiden. Konfrontation ist nicht angenehm, doch sie gehört zum Prozess. Eine Trennung – etwa von den Eltern – ist mit Reibung verbunden, Gefühle wie Zorn und Wut sind typischerweise involviert.
Wir konfrontieren Gefühle und investieren aktiv Zeit in die Krisenbewältigung.
Manche entscheiden sich, eine Reise nach Südamerika zu machen, anstatt eine Therapie in Angriff zu nehmen. Vielleicht wäre die Konfrontation mit den eigentlichen Problemen wertvoller.
…was uns womöglich zu Ihnen führt.
(Lacht) Oder zu meiner Kollegin!
Bis zu 300 Studierende und Doktorierende werden von Jean Ducotterd und Rita Rämy bei der psychologischen Beratungsstelle betreut. Sie sind an der Route-Neuve 7A, 1700 Freiburg (Eingang rechts) zu finden. Mehr Informationen sind unter http://www.unifr.ch/cpe/de/index.html erhältlich.