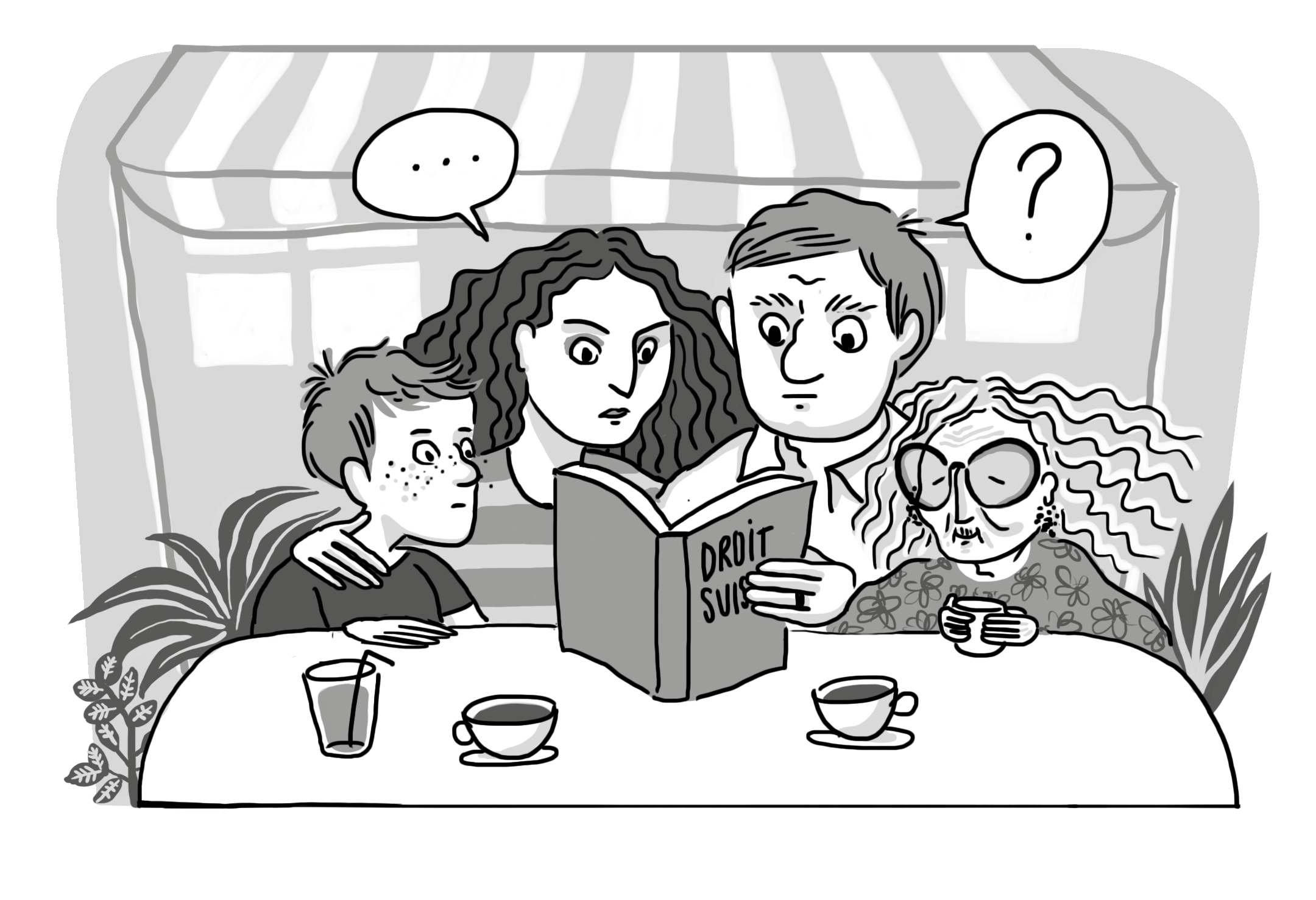In den Vorlesungssälen wimmelt es von Töchtern von Anwälten und Söhnen von
Ärztinnen. Arbeiterkinder sind hingegen unterrepräsentiert. Eine Suche nach Ursachen mit Margrit Stamm, emeritierte Freiburger Professorin der Erziehungswissenschaften.
In der Schule wird einem oft gesagt: „Wenn du dir genug Mühe gibst, kannst du beruflich alles schaffen.“ Studien zeigen gemäss einem Bericht des Schweizerischen Wissenschaftsrates (SWR) hingegen auf, dass anhand des sozioökonomischen Umfeldes der Eltern bereits vorhergesagt werden kann, wie der Bildungsweg eines Kindes verlaufen wird. Ist die Schweiz also doch nicht das Land der unbegrenzten Bildungsmöglichkeiten?
Überhaupt nicht. Verschiedenste neue Studien zeigen, dass die Schweiz Probleme mit der sozialen Gerechtigkeit hat. Es gibt eine relativ starke Bildungsungleichheit. Alle können kann zwar werden, was sie wollen, wenn – und diese Präzisierung ist entscheidend – sie Glück haben. Die soziale Herkunft ist, in der Schweiz gar noch deutlicher als in anderen Ländern, die stärkste Variable für die Entwicklung der beruflichen Laufbahn einer Person.
Wie wird diese soziale Herkunft unterschieden?
Indem ein Index gebildet wird, der die Indikatoren Beruf und Ausbildung der Eltern sowie die Bildungsnähe des Elternhauses, erfasst durch die Anzahl Bücher und durch das Vorhandensein anderer kultureller Ressourcen wie klassischer Literatur, einschliesst. So wird erfasst, ob Kinder aus einem bildungsaffinen oder eher aus einem bildungssystemfernen Milieu stammen. Kinder aus bildungsaffinem Umfeld, deren Eltern oft Akademiker und Akademikerinnen sind, haben bei gleichen kognitiven Fähigkeiten eine dreimal so hohe Chance, ins Gymnasium zu kommen, wie Kinder aus einfachen Verhältnissen. Im Vergleich zu Eltern ohne Berufsausbildung ist die Chance gar siebenmal so hoch.
Geht es bei denjenigen Eltern, welche ihre Kinder nicht unterstützen, um eine Frage des Wollens oder des Könnens?
Es spielt sicherlich beides mit. Meiner Einschätzung nach versucht der kleinere Teil der Eltern, ihre Kinder wirklich zu unterstützen und steht dann zudem meistens vor finanziellen Problemen. Bildungsaffine Familien geben oft viel Geld für Nachhilfestunden aus und ermöglichen ihren Kindern so einen Vorteil. Noch wichtiger ist jedoch der Faktor, dass bildungssystemferne Eltern dem Gymnasium gegenüber oft zurückhaltend eingestellt sind, da sie selbst zumeist kaum Berührungspunkte mit dieser Welt haben. Dazu kommen sehr schnell finanzielle Überlegungen – wenn das Kind eine Berufslehre macht, steht es schon viel früher auf eigenen Beinen. Diese skeptische Haltung beeinflusst die betroffenen Jugendlichen enorm und führt dazu, dass sie eine sogenannte Aufstiegsangst entwickeln.

Der SWR schreibt, dass die Schule soziale Ungleichheiten nicht ausgleiche, sondern gar verstärke. Wie ist das angesichts der vielfältigen Förder- und Unterstützungsmassnahmen möglich?
Ein wesentlicher Punkt ist der Eintritt in den Kindergarten. In unseren Studien haben wir festgestellt, dass bereits zu diesem frühen Zeitpunkt ein grosser Unterschied zwischen Kindern aus gutsituierten Familien und Kindern aus einfachen Milieus besteht. Dies betrifft nicht nur schulische Kompetenzen wie das Lesen, das Schreiben oder das Rechnen; sie wissen auch besser, wie sie sich den Autoritätspersonen gegenüber verhalten sollten, weil sie einen entsprechenden Habitus entwickelt haben. Der Schule gelingt es im Anschluss dann nicht mehr, diesen Wissensvorsprung zu schliessen. Es profitieren zwar alle von der Förderung während der Schulzeit, diejenigen mit bereits vorhandenen Grundkenntnissen jedoch ungleich mehr. Man spricht dann vom Matthäus-Effekt: Wer hat, dem wird gegeben.
Wie kann die Schule diese Ungleichheiten ausgleichen?
Die Schule kann die kaum ausgleichen. Sinnvoller wäre die Frage, wie die Startbedingungen von Kindern gefördert werden können, dass sie zumindest weniger ungleich sind. Es reicht nicht, dass alle den scheinbar gleichen Zugang zu Bildung haben. Vielmehr müssen Schülerinnen und Schüler mit bestimmten Begabungen so gefördert werden, dass sie diese tatsächlich entfalten können. Häufig heisst Förderung heute einfach, dass Defizite ausgebessert werden. Die vorhandenen Stärken werden oft nicht gleichermassen gesehen. Um die entstehenden Ungleichheiten tatsächlich zu verhindern, müssten die Kinder bereits als Dreijährige gefördert und gebildet werden.
Bestehen für ein Studium noch zusätzliche Eintrittshürden?
Dies ist ein Schritt auf dem Bildungsweg, der oft etwas vernachlässigt wird. Deutsche Untersuchungen zeigen, dass auch hier wieder ein Teil der Arbeiterkinder gar kein Studium beginnt. Neben den finanziellen Herausforderungen bedeutet ein Studium meistens auch, von vielen Akademikerkindern umgeben zu sein. Hier haben viele wiederum Zweifel, ob sie sich in diesem Milieu zurechtfinden: Es geht um Bedenken, ob man der akademischen Sprache überhaupt gewachsen sei und einen entsprechenden intellektuellen Habitus entwickeln kann, aber auch darum, ob man zum Beispiel der Uni entsprechende Tischmanieren hat. Es ist darum zu beobachten, dass überdurchschnittlich viele Kinder aus bildungsfernem Umfeld eine andere Ausbildung, manchmal auch eine Fachhochschule, wählen.
Braucht die Schweiz überhaupt mehr Akademikerinnen und Akademiker?
Nein. Ich bin dezidiert der Meinung, dass unsere aktuelle Akademikerquote auf einem gesunden Niveau ist. Wir haben weltweit eines der besten Durchlässigkeitssysteme. Ich wehre mich aber gegen die These, dass ja nicht alle intellektuell begabten und interessierten Arbeiterkinder studieren müssten, weil gute Leute auch in der Berufsbildung gebraucht würden. Intellektuell begabte Kinder sollten einen akademischen Weg einschlagen – unabhängig davon, ob sie aus gutsituierten oder aus einfachen Verhältnissen kommen. In unseren Gymnasien sind aber fast ausschliesslich Jugendliche mit bildungsaffinen Eltern, während beinahe alle Lehrlinge Arbeitereltern haben. Dies ist kein zukunftsträchtiger Zustand. Wenn die Neigungen, Begabungen und Interessen tatsächlich handlungsleitend wären, hätten wir eine ausgewogenere Situation. Es sollten jene studieren, die das intellektuelle Rüstzeug haben, und andere nicht, welche eigentlich eher an der Praxis als an der wissenschaftlichen Auseinandersetzung interessiert sind.
Akademiker und Akademikerinnen und Arbeiterinnen und Arbeiter kennen ihren jeweiligen Berufsweg am besten und können so ihre Kinder ideal unterstützen, wenn diese einen ähnlichen einschlagen. Das ist doch gesellschaftlich sehr effizient.
Ja, das ist in der Tat effizient. Wenn wir uns als demokratische Gesellschaft aber Chancengleichheit auf die Fahne schreiben, darf der Bildungsweg nicht von den Eltern abhängen. Die Eltern haben mit dem aktuellen System einen viel zu grossen Einfluss darauf, was aus ihrem Kind wird. Wenn wir Gerechtigkeit wollen, müssen die Fähigkeiten des Kindes und nicht dessen Familie im Mittelpunkt stehen.
Profitiert die akademische Welt von mehr Arbeiterkindern?
Wenn mehr Personen aus gutsituierten Familien nicht studieren würden, weil sie das nötige Rüstzeug eigentlich nicht mitbringen – das mag jetzt etwas eigenartig klingen – und stattdessen mehr begabte und interessierte Jugendliche aus einfachen Verhältnissen ein Studium in Angriff nähmen, hätten wir mehr intrinsisch motivierte Studierende. Arbeiterkinder, welche wirklich aufgrund ihrer Leidenschaft studieren und nicht, um die Erwartungen ihrer Eltern zu erfüllen, würden die Universitätsgemeinschaft bereichern.