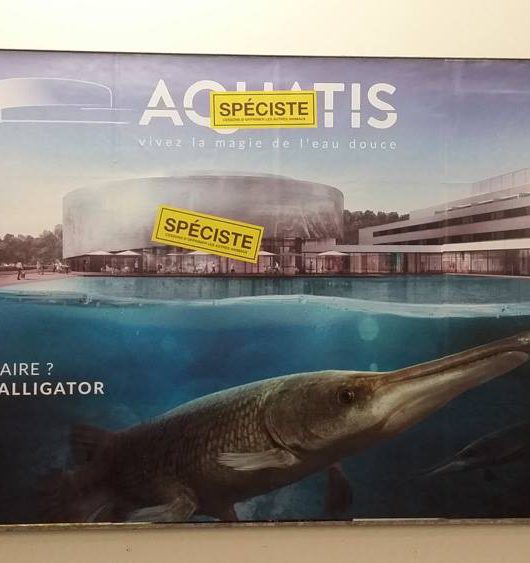Nach Monaten des Stillstands im Literaturbetrieb fanden diesen Sommer endlich wieder die ersten Lesungen statt. Wie beispielsweise jene der preisgekrönten Kolumnistin und Bestseller-Autorin Nina Kunz. Ihr erstes Buch «Ich denk, ich denk zu viel» ist ein Einblick in ihre Gedankenwelt. Diesen gewährt sie auch uns, als wir sie in Bern kurz vor ihrer ersten Lesung seit Beginn der Pandemie treffen. Ein Gespräch über das Frausein im Journalismus, unausweichliche Widersprüche im Kapitalismus und Sinnhaftigkeit im Schreiben.
Spectrum: Der Titel deiner Textsammlung ist «Ich denk, ich denk zu viel». Kann man zu viel denken?
Nina Kunz: Denken kann etwas sehr Ambivalentes sein. Es gibt produktives Denken und es gibt zielloses Grübeln.
Für mich hört sich der Titel auch nach Selbstzweifel an.
Mit dem Titel wollte ich eher auf die Gedankenkarusselle anspielen. Der Titel soll vermitteln: Hier geht’s jetzt dann gleich ums Grübeln und um Ängste. Denn «Unbehagen» und «Angst» sind die stärksten Gefühle, mit denen ich durch die Welt gehe.
Beeinflussen dich diese Gefühle auch in deiner Arbeit?
Natürlich. Beim Schreiben nimmt man schliesslich Raum ein mit seinen Gedanken und seiner eigenen Person. Es braucht Überwindung, sich so zu exponieren – vor allem, wenn man sich dabei ständig fragt: Könnten andere das nicht besser? Masse ich mir was an, wenn ich Raum einnehme? Bin ich narzisstisch?
Ist das nicht auch ein Frauen-Ding?
Nun, ich kenne viele schreibende Menschen, die am sogenannten Imposter-Syndrom leiden – also permanent denken, sie fliegen bald als Nichtskönner*innen auf. Das ist meiner Meinung nach nicht etwas Geschlechterspezifisches. Trotzdem gibt es wohl eine Geschlechterdimension, die ich jedoch nur schwer in Worte fassen kann. Vielleicht kann ich es so sagen: Ich höre seltener einen Mann sagen, er sei für etwas nicht qualifiziert.
Im Kapitel «Bravo Girl» schreibts du: «Eigentlich will ich im Alltag gar nicht über mein Frausein nachdenken. (…) Aber damit veräppele ich mich nur selbst.» Wie übersetzt sich dein Frausein in deine Arbeit?
Eigentlich will ich nicht das «other» sein. Daher verstehe ich zum Beispiel auch Autorinnen – zumindest auf eine Art – die nicht Schriftstellerinnen genannt werden wollen, sondern Schriftsteller. Dies, weil sie nicht auf ihr Frausein beschränkt werden wollen.
Und trotzdem nennst du dich Schriftstellerin und nicht Schriftsteller.
Ja. Denn meiner Meinung nach schafft man nicht erst durch die Benennung eine Ungleichheit. Die Ungleichheit ist schon vorher da.
Erlebst du selbst Ungleichheit und Diskriminierung?
Ja – wobei mich als Autorin vor allem beschäftigt, dass «Diskriminierung» so viele Facetten haben kann und manchmal total offensichtlich, manchmal aber auch total diffus daherkommt.
Wann tauchte dein Unbehagen mit dem «Frau-Sein» erstmals auf?
Das war in der Pubertät, als ich merkte, dass es gar nicht so easy ist, eine «Frau» zu sein – sondern die Frauenrolle ein seltsames, ausschliessendes Konstrukt ist, das viel Arbeit macht. Damals begannen die Jungs auch über Haare an Beinen zu lachen oder über kleine Brüste. Als Teenager spürte ich: hier verschiebt sich etwas, das ich nicht cool finde, aber auch nicht benennen kann.
Heute ist es dein Job, solche schwer greifbaren Sachen zu benennen und diffusen Gefühle in Worte zu fassen.
Solche Erfahrungen haben mich auf jeden Fall zum Schreiben gebracht. Ich musste Texte verfassen, um mir selbst die Welt zu erklären. Vielleicht, so denke ich manchmal, hätte es diesen Drang zum Schreiben nicht gegeben, wenn ich nicht als Frau aufgewachsen wäre.
Erlebst du das «Unbehagen des Frauseins» auch im Journalismus?
Als Journalistin wird man teils anders behandelt als seine männlichen Journalistenkollegen. Vor allem, als ich anfing, hiess es noch oft: ‘Das ist eine Frauengeschichte’.
Kannst du ein Beispiel geben?
Bei einem Job passierte es einmal, dass ich die einzige Person im Raum war ohne Kinder und gleichzeitig die einzige Frau. Als es dann um ein Kita-Thema ging, schauten alle Väter im Raum mich an. In solchen Momenten merkt man: ‘Aha, es gibt hier also bestimmte Zuschreibungen.’.

Wie kommt es, dass gewisse Stories und Themen anscheinend als «Männer-» oder «Frauenthemen» gelesen werden?
Riesige Frage… Aber wahrscheinlich hat das unter anderem damit zu tun, dass wir das «Gefühlige» und Subjektive aufgrund der Geschichte eher mit Frauen in Verbindung bringen und das Nüchterne, Objektive eher mit Männern. Wir sind es uns daher auch gewohnter, – vor allem weisse, privilegierte – Männer in Expertenpositionen zu sehen – und ihnen zuzuhören, wenn sie scheinbar neutral über die Welt berichten. Bei Frauen oder anderen Gruppen hingegen heisst es schnell, man schreibt oder denkt jetzt «als Frau», kommt also von einer ganz persönlichen, subjektiven Perspektive.
Macht eine Frau im Journalismus grundsätzlich andere Erfahrungen als ein Mann?
Grundsätzlich weiss ich nicht… Aber ich selbst habe schon immer wieder eigenartige Erlebnisse. So wollte ein Veranstalter etwa kürzlich, dass ich in einem eleganten Abendkleid an die Lesung komme. Ich kann mir kaum vorstellen, dass er einem Mann gesagt hätte, ziehe doch bitte einen sexy Smoking an.
Kommen wir nochmal zurück zu dir. Du schreibst, du seist in einem kleinen Matriarchat, also mit deiner Mutter und deiner Grossmutter, aufgewachsen. Welchen Einfluss hatte das auf dich?
Ich hatte das Gefühl, Frauen können alles machen. Vor allem aber dachte ich: Frauen können schreiben. Denn meine Mutter war ebenfalls Journalistin. Meine frühste Erinnerung ist, wie sie irgendwo im Schneidersitz im überfüllten Zug sitzt und in ihr Notizbuch schreibt. Lange war mir als kleines Kind nicht klar, wofür man Männer überhaupt braucht. Alles funktionierte nur mit Frauen (lacht).
Deine Mutter war alleinerziehend und eure Verhältnisse dementsprechend einfach.
Wir hatten zwar wenig Geld, aber wir hatten immer Bücher. Für mich war es eine Selbstverständlichkeit, Silvia Plath und Toni Morrison im Regal zu haben. Und dafür bin ich enorm dankbar.
Diese Bücher prägten sicherlich auch deinen heutigen Blick auf die Welt. Du benutzt Gendersternchen, bist kapitalismuskritisch, und schreibst über Feminismus.
Ja. Sprache hat mir schon immer geholfen, zu verstehen, was gerade passiert – und vor allem habe ich erst durch die Bücher von Autor*innen wie Laurie Penny, Reni Eddo-Lodge oder Naomi Klein begriffen, dass das Alltägliche auch mit grösseren Strukturen zusammenhängt.
In deinem Buch genderst du auch mit Gendersternchen.
Ja, das war eine lustige Geschichte. Die Schriftart, die wir für mein Buch gewählt haben, hatte kein Asterisk. Darum gibt es im Buch jetzt einfach diese super auffälligen, fetten «Zimtsterne» als Gendersternchen (lacht).
Du schreibst auch für viele grosse, teils etwas alteingesessene Zeitungen, die nicht ganz so «woke» sind, und es auch nicht sein wollen.
Ich finde es grundsätzlich schön, dass es Medien gibt, die eine grosse Bandbreite an Haltungen abdecken. Ich lese selbst auch immer gerne Texte von Menschen, deren Meinungen ich nicht teile.
Du schreibst also auch gerne für Leute ausserhalb deiner Bubble?
Für seine eigene Bubble zu schreiben, ist immer viel einfacher. Wahrscheinlich würde ich zugespitzter schreiben, würde ich nicht für ein so grosses Publikum schreiben. Aber genau die Breite der Leser*innenschaft finde ich so toll – es ist aber auch eine grosse Herausforderung.
Kannst du das erklären?
Es zwingt mich konstant, meine Argumente zu hinterfragen. Als Autorin ist es ein riesiges Geschenk, wenn man merkt, dass etwas lediglich eine Meinung war und gar kein wirkliches Argument. Es zwingt einen dazu, Fakten für seine Meinungen zu finden. Oder auch: Seine Meinung mal zu revidieren.
Dieses Gespräch führen wir für die Studierendenzeitschrift der Universität Fribourg. Auch für dich war die Studierendenzeitschrift in Zürich ein erster Berührungspunkt mit dem Journalismus.
Nicht ganz. Ich habe tatsächlich im Gymnasium bei der Gymi-Zeitung mitgemacht, was aber sozialer Selbstmord war, weil die anderen beiden Redaktionsmitglieder der Latein- und der Deutschlehrer waren. Im Studium war ich dann bei der Zürcher Studierendenzeitung. Die Arbeit dort hat einfach immer gefäggt und forderte mich auf eine gute Art. Im Nachhinein war diese Zeit die beste meines Lebens. Ich hatte noch nie so ein Gefühl von Sinnhaftigkeit wie bei der Studierendenzeitung. Ich werde sofort nostalgisch, wenn ich an die Zeit bei der Studierendenzeitung denke…
Jetzt ist das Schreiben dein Beruf und du gehörst zu den erfolgreichsten Journalistinnen des deutschsprachigen Raums. Du sagst jedoch selbst, es sei nicht einfach, in diesem Beruf Geld zu verdienen. Lohnt es sich trotzdem noch, diesen Weg einzuschlagen?
Aus meiner Perspektive ist Journalismus nach wie vor der tollste Job, den es gibt. Mittlerweile schicken mir Leute ihre Texte oder fragen mich, wie mein Werdegang war. Im Nachhinein lässt sich natürlich immer ein rundes Narrativ kreieren, aber in Wirklichkeit war es ziemlich random. Die Arbeit bei der Studierendenzeitung hat mich aber enorm viel gelehrt und es ist schön zu sehen, wie auch viele meiner damaligen Kolleg*innen im Journalismus Fuss gefasst haben.
Du schreibst im Buch bezüglich deiner Arbeit vom «Wursteln». Aus Angst, sich auf das Falsche festzulegen, werkelst du lieber in der Mikroperspektive vor dich hin. Gibt es in deiner Arbeit ein übergeordnetes Ziel?
Schreiben kam bei mir immer schon aus einer Dringlichkeit. Seit ich denken kann, empfinde ich die Welt als weird. Jedes diffuse Unbehagen oder Fragezeichen, das auftaucht, probiere ich durch meine Arbeit irgendwie zu ordnen und unter Kontrolle zu bringen. Das übergeordnete Ziel ist also, nicht durchzudrehen.